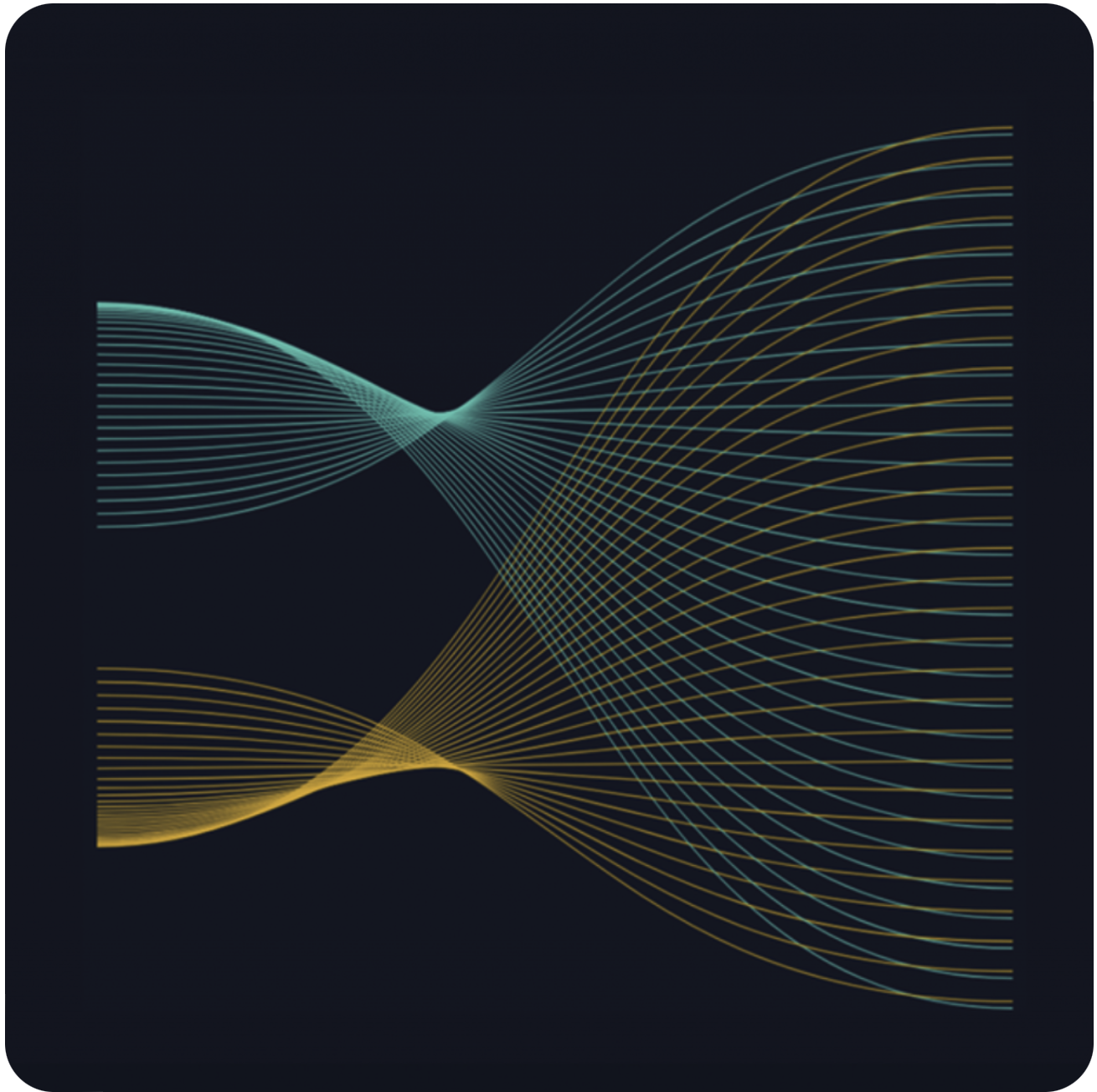Es gibt Fälle, die sich nicht abschließen lassen. Cum-Ex gehört dazu. Juristisch ist vieles entschieden, politisch manches versandet, medial ist das Thema weitergezogen. Und doch bleibt etwas Unaufgelöstes zurück. Je größer der zeitliche Abstand wird, desto deutlicher zeigt sich: Cum-Ex war kein isolierter Ausrutscher, sondern ein Vorgang, der nur möglich war, weil ein komplexes System über Jahre hinweg nicht als solches betrachtet wurde.
Irritierend ist nicht allein die Raffinesse der Konstruktionen, sondern die jahrelange Folgenlosigkeit, die sich trotz Kenntnis, Warnungen und erster Aktivitäten einstellen konnte: Man wusste davon, man sprach darüber, man wurde tätig – und dennoch blieb das Geschehen lange nicht wirksam begrenzt. Dass ein Vorgang, der heute als milliardenschwerer Steuerschaden gilt, über Jahre hinweg innerhalb bestehender Regelwerke fortwirken konnte, ohne frühzeitig mit der nötigen Durchschlagskraft eingedämmt zu werden. Die Frage, die sich daraus ergibt, ist unbequem, weil sie weniger nach Schuld fragt als nach Struktur.
Warum erkennt der Staat solche Entwicklungen meist erst dann, wenn sie bereits Wirkung entfaltet haben?
Steuergesetze entstehen selten mit böser Absicht und oft auch ohne große politische Dramatik. Sie sind das Ergebnis von Kompromissen, fachlichen Abwägungen und zeitlichem Druck. Jede einzelne Regelung folgt einer eigenen inneren Logik: Sie reagiert auf einen konkreten Anlass, schließt eine bekannte Lücke oder verfolgt ein politisches Ziel. Für sich genommen ist dieses System erstaunlich rational und meist auch gut begründet. Seine Probleme beginnen nicht im Einzelnen, sondern im Zusammenspiel.
Denn Gesetze verhalten sich nicht additiv. Sie wirken nicht wie Bausteine, die sich einfach aneinanderfügen lassen. Sie verhalten sich interaktiv. Ihre Wirkung entsteht dort, wo sie auf andere Regelungen treffen, auf bestehende Definitionen, auf internationale Abkommen oder auf Verwaltungspraxis. Eine Übergangsregelung entfaltet eine andere Bedeutung, wenn sie zeitlich mit einer internationalen Vorschrift zusammenfällt. Eine Definition verschiebt ihre Wirkung, wenn sie mit einem Wahlrecht kombiniert wird. Ein scheinbar technischer Stichtag gewinnt Gewicht, wenn er mit bilanziellen oder verfahrensrechtlichen Vorgaben korrespondiert. Solche Effekte sind in der Theorie bekannt. In der Praxis bleiben sie oft unbeobachtet – vor allem dann, wenn sie sich nicht sofort zeigen, sondern erst Jahre später, verteilt über viele Akteure und häufig jenseits nationaler Grenzen.
Hier beginnt die strukturelle Asymmetrie.
Große Wirtschaftsakteure, insbesondere im Finanz- und Konzernbereich, sind es gewohnt, in solchen Wechselwirkungen zu denken. Sie analysieren Regelwerke nicht isoliert, sondern als Gesamtgefüge. Ihre Berater simulieren Szenarien, prüfen Grenzfälle, betrachten internationale Effekte und zeitliche Verschiebungen. Nicht aus politischem Kalkül, sondern aus ökonomischer Rationalität. Wer in einem hochregulierten Umfeld agiert, muss das Regelwerk als System verstehen, um sich darin bewegen zu können.
Diese Systemperspektive ist nicht nur intern wirksam, sie hat eine sichtbare Außenseite. Man kann beobachten, wie Themen „bearbeitet“ werden: in Stellungnahmen zu Referentenentwürfen, in Verbandspositionen, in Fachartikeln, Mandanteninformationen und Konferenzprogrammen. Man erkennt, wann aus einer abstrakten Norm eine operative Frage wird – wenn sich die Sprache verschiebt, wenn plötzlich von „Prozessen“, „Nachweispflichten“, „Erstattungsabläufen“ oder „Interpretationsspielräumen“ die Rede ist. Man erkennt auch typische Absicherungsmuster: die Häufung von Verweisen auf Gutachten, die Formelhaftigkeit von Begriffen wie „Marktstandard“ oder „Best Practice“, das routinierte Argumentieren mit Wettbewerbsfähigkeit, Komplexitätslast und angeblicher Alternativlosigkeit der Praxis.
Solche Signale sind für sich genommen kein Beweis und sollen es nicht sein. Sie sind Indikatoren dafür, dass ein Regelungsbereich wirtschaftlich relevant wird, dass Skalierung gedacht wird, dass Prozesslogiken entstehen, die später nur schwer rückgängig zu machen sind. Gerade bei grenzüberschreitenden Strukturen kommt hinzu, dass Interpretationen und Nachweisregime in mehreren Jurisdiktionen zusammenlaufen: Abkommen, Quellensteuerlogiken, wirtschaftliche Berechtigung, Intermediärketten, Zuständigkeiten. Die technische Frage („Wie wird abgewickelt?“) und die rechtliche Frage („Wie wird begründet?“) verschränken sich früh – und häufig lange, bevor eine Kontrollinstanz überhaupt Anlass sieht, genauer hinzusehen.
Der Staat hingegen ist anders organisiert. Gesetzgebung, Verwaltung, Prüfung und Strafverfolgung sind funktional getrennt. Diese Trennung ist sinnvoll; sie schafft Kontrolle und Spezialisierung. Doch sie hat einen Preis: den Verlust des Gesamtblicks. Zuständigkeiten enden dort, wo andere beginnen. Was fehlt, ist nicht Kompetenz, sondern systematische Zusammenführung.
Das zeigt sich besonders deutlich bei der Strafverfolgung. Staatsanwaltschaften werden tätig, wenn ein konkreter Verdacht vorliegt. Doch systemische Steuerschäden entstehen nicht punktuell. Sie entwickeln sich schrittweise, verteilt über viele Akteure, oft grenzüberschreitend. Bis ein Anfangsverdacht entsteht, ist der Schaden häufig längst eingetreten. Hinzu kommt ein Missverhältnis der Ressourcen: Während tausende kleinere Verfahren dauerhaft Kapazitäten binden, erfordern große wirtschaftliche Sachverhalte jahrelange Arbeit hochspezialisierter Teams. Die größten Schäden sind oft die am schwersten greifbaren.
Was dabei leicht übersehen wird: Für eine frühere Erkennung wären keine geheimen Informationen nötig. Die relevanten Quellen sind öffentlich. Auf der Staatsseite sind es Gesetze, Begründungen, Drucksachen, Anhörungen und Konsultationspapiere. Auf der Wirtschaftsseite sind es Verbandsdokumente, öffentliche Fachpublikationen, Positionspapiere, die Sprache von Beratungs- und Kanzleikommunikation, die Verbreitung bestimmter Narrative und Absicherungsformeln. Was fehlt, ist nicht Transparenz, sondern eine Perspektive, die diese Materialien nicht einzeln liest, sondern in Beziehung setzt – Normtext zu Begründung, Begründung zu Verwaltungspraxis, Verwaltungspraxis zu Prozesslogik, Prozesslogik zu den sichtbaren Reaktionen der Marktakteure.
Das Besondere liegt nicht im Zugang zu Informationen, sondern in der Methode: Das Gesamtsystem aus Gesetzen, Verordnungen und Verwaltungspraxis wird als dynamischer Wirkungsraum modelliert – inklusive Querverweisen, Ausnahmen, Wahlrechten, Übergängen, Zeitachsen, Nachweispflichten sowie Erstattungs- und Anrechnungslogiken – und zugleich werden die öffentlich sichtbaren Reaktionsmuster der Wirtschaftsseite als Frühindikatoren erfasst (Publikationsdichte, Operationalisierung, Gutachten-/„Marktstandard“-Sprache, Narrative). Lücken entstehen meist aus Wechselwirkungen; deshalb zielt Prävention auf Mustererkennung im Zusammenspiel von Normen und Verhalten, nicht auf Einzelfallverdacht.
Eine solche Perspektive hätte wenig mit Empörung zu tun. Sie würde keine Täter benennen, keine Forderungen formulieren, keine politischen Kampagnen ersetzen. Sie würde schlicht fragen, wo im Zusammenspiel bestehender Regelungen Anreize entstehen, die bei rationalem Verhalten genutzt werden könnten. Das ist keine moralische, sondern eine analytische Frage. Aber sie ist zentral, wenn man verhindern will, dass der Staat stets im Rückspiegel agiert.
Vielleicht liegt hier die eigentliche Lehre aus Cum-Ex. Nicht, dass der Staat härter oder misstrauischer werden müsste, sondern dass er früher systemisch hinschauen sollte. In einer Welt, in der wirtschaftliche Akteure längst in Modellen, Szenarien und Wechselwirkungen denken, wirkt es zunehmend anachronistisch, staatliche Steuerung vor allem linear zu organisieren.
Der Schaden entsteht nicht dort, wo jemand besonders klug ist. Er entsteht dort, wo Komplexität unbeobachtet bleibt. Und solange sich daran nichts ändert, wird der Staat auch künftig manches erst dann erkennen, wenn es längst geschehen ist.
Was man von außen tatsächlich sehen kann
- Gesetzgebungsphase: Stellungnahmen zu Entwürfen, Verbandspositionen, Änderungswünsche, Begründungsnarrative
- Operationalisierung: Sprache verschiebt sich von Normen zu Prozessen („Nachweise“, „Erstattungsabläufe“, „Dokumentationspakete“)
- Absicherung: Häufung von Verweisen auf Gutachten, Formelbegriffe wie „Marktstandard“/„Best Practice“
- Skalierungssignale: hohe Publikationsdichte in kurzer Zeit, Konferenzen/Updates/„Alerts“ in Serien, Standardisierung von Argumentationslinien
- Cross-Border-Flächen: Hinweise auf DBA/Quellensteuer, wirtschaftliche Berechtigung, Intermediärketten, Zuständigkeitsverdünnung